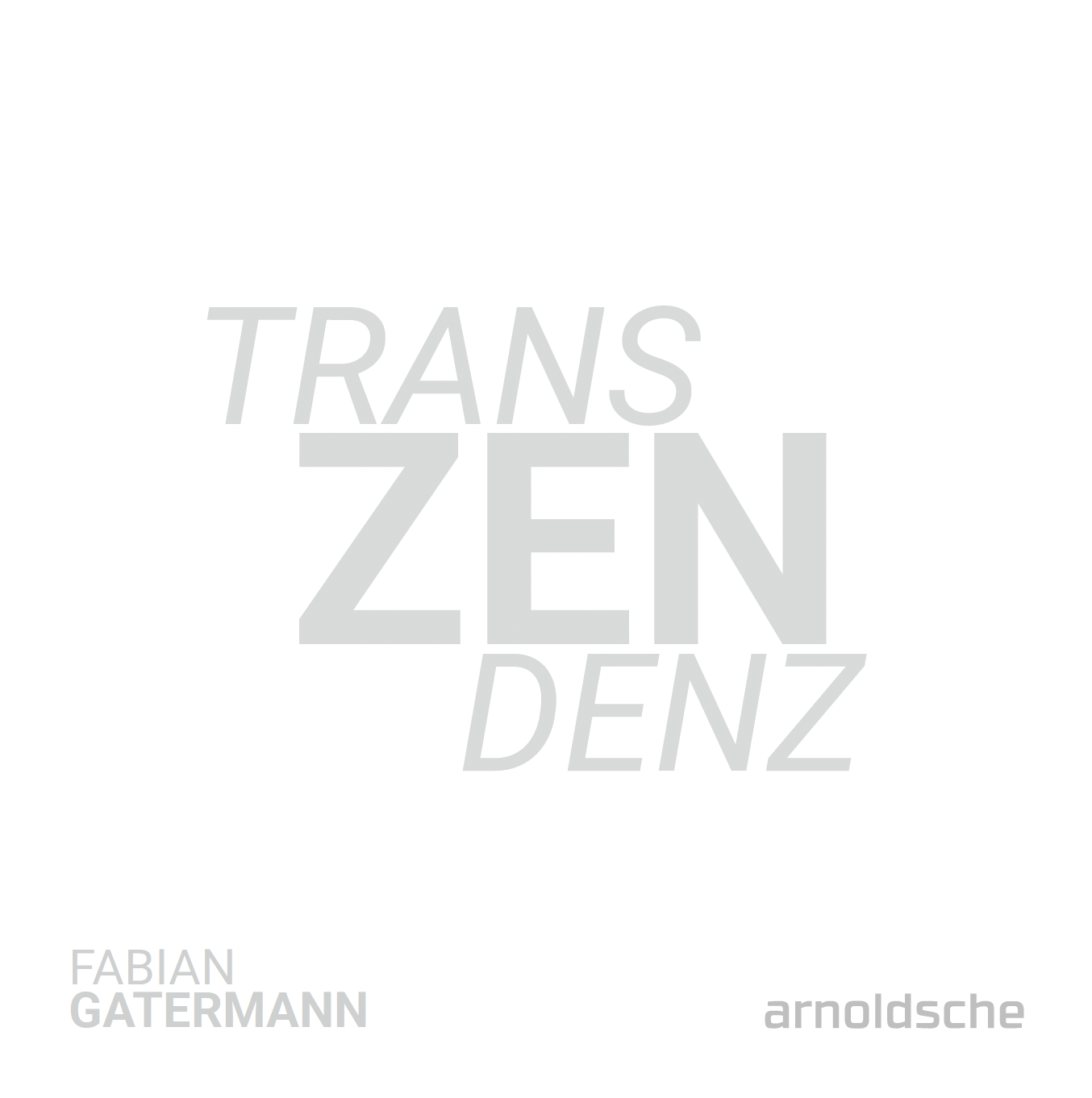Kein Licht, kein Werk
Wer den Katalog von Fabian Gatermann durchblättert, der blickt auf eine Fülle von Werken, die sich – bei aller Vielfalt – doch ganz um eines drehen: Licht. Der Künstler arbeitet immer anders, aber immer mit Licht. Behält man gängige Klischees im Kopf, fragt man sich, wie das gehen soll. Der Maler nimmt den Pinsel in die Hand und bringt Farbe auf eine Leinwand. Der Bildhauer bearbeitet mit Hammer und Meißel den Stein. Und Fabian Gatermann, der greift zum Licht? Unmöglich, denn Licht ist unbegreiflich – und das nicht nur im Sinne des Anfassens. Nicht mal sehen kann man es. Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich durch den Raum bewegt, eine Energieform, die sich ausbreitet, aber keine physische Substanz besitzt. Das, was Licht bewirkt, das nehmen wir wahr, aber für das Licht an sich sind wir blind. Wenn es überhaupt eine Form der Beschreibung gibt, dann etwa durch die Charakterisierung von Wellenlänge, Frequenz oder Intensität. Wie nüchtern, wie sachlich, wie unbefriedigend. Den reinen Naturwissenschaftler*innen mag dies genügen, nicht jedoch jemandem, der die Welt darüber hinaus befragt.
Licht ist da, aber man sieht es nicht. Licht braucht anderes, um in Erscheinung zu treten. Seltsam, in welcher Abhängigkeit es steckt, wenn es doch selbst das ist, was anderes erst möglich macht – Wachstum zum Beispiel. Gäbe es kein Licht, sähe unsere Natur alt aus. Fabian Gatermann, so könnte man meinen, schert sich als Künstler um die Natur eher weniger. Denn er gehört doch – folgt man so einigen Kurator*innen – der Konkreten Kunst an.[1] Mit der Natur hat die Konkrete Kunst wenig zu tun. Hat sie sich nicht vor rund 100 Jahren mit großer Anstrengung davon befreit, ihr und ihren Phänomenen ein Abbild geben zu wollen? Das zumindest hat Theo van Doesburg 1930 mit seinen Verbündeten in den Grundlagen zur Konkreten Kunst klargemacht, in denen es heißt: „Das Kunstwerk muss vor seiner Ausführung vollständig im Geist entworfen und ausgestaltet worden sein. Von der Natur, von Sinnlichkeit oder Gefühl vorgegebene Formen darf es nichts enthalten.“[2] Das mag alles gegolten haben. Aber das ist eben bereits 100 Jahre her. Die Konkrete Kunst hat sich – und damit auch ihr striktes gestalterisches wie inhaltliches Linien- und Grenzenziehen – weiterentwickelt und erlaubt sich inzwischen so manche Überschreitung. Und so bringt Gatermann in Werken, wie den Flowers, Prinzipien der Konkreten Kunst mit Phänomenen der Natur zusammen. Was man darin zu erblicken glaubt, sind Blumen. Doch sie entstehen anders als etwa im Naturalismus, bei dem man versuchte das „echte Leben“ möglichst nah am Original abzubilden. Stattdessen schafft Gatermann eine Zeichnung via Stift und Plotter mithilfe eines kurzen Softwarecodes, der eine Art Zellteilung beschreibt und definiert, wann und wie sich ein Strich teilt. Das entstandene Gerippe beträufelt er durch eine Pipette punktuell mit Wasser, sodass sich aus dem Strichgebilde farbige, florale Motive ergeben, die eben nicht mehr vom Code, sondern von der Fügung getrieben werden, einen zerstörenden Moment in sich tragen und so unvorhersehbar sind, wie es Wissenschaftler auch bei Wachstumsprozessen in der Natur selbst beobachten. Gatermann hat damit eine neue Rolle als Künstler, die sich von der Vorstellung eines „Künstlergenies“ entfernt. Denn nicht er ist es, der hier gestaltet, sondern er stößt eine Transformation an – und damit ist er ganz bei der Konkreten Kunst. Am Ende schafft der Prozess selbst eine eigene Ästhetik.
Gerade die Lust am Experiment, das Arbeiten mit und an Versuchsanordnungen, die Erkenntnis, dass oftmals Serien Prinzipien am anschaulichsten erklären können, ist das, was Konkrete Kunst und Wissenschaft verbindet. Fabian Gatermann musste – wie so oft in seiner Kunst – sehr lange nach dem richtigen Material suchen, damit sich der Prozess, den er ins Zentrum stellt, auch ins Bild setzen ließ. Bei den Flowers ist es zentral, dass Farbe fließen und in verschiedene Farbbestandteile aufgehen kann. So durfte es kein Büttenpapier und kein beschichtetes Papier sein. Am Ende war nur das Japanpapier geeignet. Vieles funktioniert in der Kunst durch ein Trial-and-Error-Verfahren, ähnlich wie man es aus der Wissenschaft kennt. Ordnung und Chaos schließen sich dabei nicht aus – nicht allein deswegen, weil das, was in ihren Bildern dargestellt wird, oftmals gar nicht so rational und eindeutig daherkommt, wie es bei der ersten Beschreibung erscheinen will, sondern ebenfalls, weil nicht zuletzt der Zufall doch häufig ein Wörtchen mitzureden hat.
So ist selbst das Verhältnis, das Fabian Gatermann zur Konkreten Kunst hat, ambivalent und schwankt. Er hat für sich seinen eigenen Weg gefunden, mit ihr umzugehen. Die Antwort auf die Frage etwa, was denn für ihn diese Kunstrichtung ausmache, lautet: „Konkrete Kunst beinhaltet für mich wertvolle Ausgangspunkte, von denen ich eigene Linien ziehe.“[3] Irgendwie fühlt er sich der Konkreten Kunst angehörig – und irgendwie nicht. Die klare Formensprache, die Reihung, die Wiederholung, die Rhythmisierung – mit all dem fühlt er sich der Konkreten Kunst verbunden und knüpft in seinen Werken genau dort an. Gleichzeitig wagt er immer die bewusste Grenzüberschreitung, ohne sich gänzlich von ihr – der Konkreten Kunst – zu lösen. Sich nur auf der Mathematik zu berufen, das reicht Fabian Gatermann nicht. In der Mathematik, in der Geometrie darf sich Kunst nicht erschöpfen. Da muss es etwas geben, das darüber hinausführt. Aber besonders der Gedanke, dass das, was wir in der Konkreten Kunst sehen, Bildmittel wie Bildinhalt zugleich ist, übt seinen besonderen Reiz auf ihn aus. Dabei macht er es sich nicht leicht, denn sein Mittel und Inhalt ist das Licht – und, das ist nun bekannt, ist so schwer ins Bild zu setzen. Wer das Licht zum Zentrum seiner Kunst macht, muss um die Ecke denken – und nicht selten auch genau damit gestalten. Fabian Gatermanns Arbeiten brauchen nicht nur das Licht, sondern zusätzlich den Raum. Gerade weil seine Fenster – die Finestra – nicht an der Wand eingelassen sind, sondern rechtwinklig von der Wand in den Raum greifen und damit eine Ecke ergeben. Da strahlt das Licht durch die gläsernen, dichroitischen, bewusst farbigen Scheiben – denn die Farbe ist ja immer Teil des Lichts – durch und malt sich je nach Tageszeit und Betrachter*innenstandpunkt wechselnde Bilder an die Wand, die nur das Auge wahrnehmen können, aber mit den Händen nicht zu greifen wären. Doch erst durch das Zusammenspiel aus dem von Gatermann gebauten Objekt und dem, was dieses durch den Lichteinfall, an der Wand erzeugt, komplettiert sich sein Werk – und ist doch nie komplett ohne die Betrachter*innen und deren individuelle Rezeption.
Ganz ähnlich geschieht es bei den LightEdges. Sie tragen ja bereits die Ecke in einer der möglichen Übersetzungen des englischen Begriffs im Namen. Sie sind Objekte aus aufeinander montierten Plexiglaskörpern, die – je nachdem, wie das Licht darauf scheint – Farbmalereien an die Wände bringen. Auch sie funktionieren, ja sie „leben“ nur dort, wo Licht und Raum aufeinandertreffen. Und gleichzeitig geben sie dabei nicht preis, wie sie der Tüftler Gatermann gemacht hat. Denn der Kleber ist nicht sicht- und doch unverzichtbar, denn er ist es doch, der alles zusammenhält. Wie lange hat er da probiert, bis das geklappt hat – und wie sehr musste er so manche Frustration und Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit oder mit dem Fortschritt aushalten. Dieser dunkle Teil ist wohl jeder Künstler*innenseele immanent, selbst wenn man es den Werken gar nicht ansieht. Am Ende gelingt die Faszination, die Kunst entfaltet, nicht selten über das auf den ersten Blick kaum Erkenntliche oder Erklärliche. So passend, dass Fabian Gatermann in seiner Installation Lichtkreuzung seine Plexiglas-Körper 2019 in der Münchner Nazarethkirche zeigte. Kirchen sind seit jeher Räume, deren Architekten sich der Kraft des Lichts bewusst waren und die diese zu inszenieren wussten. Damit gelang es ihnen, sicherlich hinter der Erkenntnis naturwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten, das ins Seh-, Spür-, ja Fühlbare zu transportieren, was in Genesis 1,3 der Anfang von allem bedeutete: Licht. Dass Fabian Gatermann sich den Kirchen- als Ausstellungsraum ausgesucht hat, wundert kaum. Nicht, weil er so bibeltreu ist, sondern weil er, der seinen Katalog bezeichnenderweise den Titel Transzendenz gegeben hat, darin mitgeht, dass es etwas gibt, das über sich hinausgeht, das übergeordnet ist. Wer nun meint, das hätte wenig mit Konkreter Kunst zu tun, der irrt und betrachtet in der Geschichte der Konkreten Kunst nur die Stränge, die sich rein auf das Mathematische wie Rationale konzentrierten und blendet Bewegungen des Anfangs aus. Kasimir Malewitsch oder Wassily Kandinsky etwa suchten sehr wohl nach einem „Geistigen in der Kunst“ und steckten damit andere Generationen an Künstler*innen an.[4]
Es gibt also noch irgendetwas anderes, so Fabian Gatermann, und das Licht ist für ihn eine Möglichkeit, dies zum Ausdruck zu bringen. Doch wer mit dem Licht arbeitet, der macht sich abhängig davon. Das hat Effekte in verschiedene Richtungen. Positiv, da sich Werke wie die LightEdges, seine Wandstelen, oder die Finestra je nach Tageszeit und Lichteinfall verändern und sie ihren Betrachter*innen nie dasselbe zu sehen geben. Negativ, wenn das Licht nicht so „arbeitet“, wie es das Kunstwerk und der Künstler brauchen würde. Wenn der Tag grau ist, dann erscheinen solche Arbeiten fast schon farblos. Da hilft nicht mal das, was sonst oftmals weiterhelfen kann: Geld. Natürliches Licht ist kaum käuflich. Ein wunderbar ironischer Moment also, dass sich bei seinen Wandstelen die gefärbten Glaselemente ausgerechnet in solchen Magazin- oder Postkartenständern befinden, die man sonst aus Verkaufsräumen kennt.
Kein Licht, kein Werk – oder eben nur ein Teil davon. Was für das natürliche Licht gilt, trifft ebenso auf das künstliche zu. Klar, das ist einfacher zu kontrollieren. Denn man kann es viel aktiver und bewusster setzen, ein- und ausschalten. Aber selbst dort existiert eine Abhängigkeit. Nimmt man nur die Superstring Arbeiten. Ohne Strom ist da nicht viel mit der Kunst. Da bleibt einfach nur ein Kasten an der Wand.
Gerade diese Werke zeigen, dass Fabian Gatermanns Kunst nicht nur vom Faktor Licht abhängig ist. Die Betrachter*innen leisten einen entscheidenden Beitrag. Sie müssen die Lichtobjekte, die Gatermann aus eigens entwickelten LEDS und Rasterlinsen, Plexiglas und Lentikularfolie schuf, mithilfe des im Rahmen integrierten Touchpads steuern und haben damit Teil an den Farbbildern, die sich vor ihnen aufmachen. Und wenn sie sich davor bewegen, dann lassen sie sich noch mehr in den Bann ziehen, sich in ein Staunen versetzen. Das ist im Grunde etwas, das bei allen Werken Gatermanns notwendig ist: Sie sind Grenzerfahrungen zwischen Skulptur, Malerei und physikalischen Phänomen und entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn die Bewegung der Betrachter*innen einsetzt und damit sich immer wieder neue Dimensionen und Perspektiven eröffnen.
Es braucht also vieles, damit die künstlerischen Ideen Fabian Gatermanns zur Umsetzung kommen. Manchmal braucht es auch viele. Etwa bei seinem jüngsten Projekt mit dem Titel Reclaim Space. Zusammen mit zahlreichen anderen Künstler*innen, weniger aus der konkreten eher aus der Graffiti- Szene, nahm er sich der Fassade des Haus2 im Kreativlabor in München an, einem kollaborativen Raum für künstlerische Produktion aus allen Sparten. Was war Gatermanns Rolle dabei? Initiator des Projekts zu sein und selbst als einer der vielen Künstler*innen aufzutreten. Womit? Natürlich, mit einer Lichtarbeit, die aus dem Schriftzug ich du er sie they es wir ihr sie besteht und über eine Hausecke platziert wurde. Das fügt sich fabelhaft in die Folge dieses Textes ein und führt dazu, den Künstler immer besser zu verstehen: Gatermann, der, der um die Ecke arbeitet, der, der um die Ecke denkt. So schuf er mit dem Haus2-Projekt Experimentierfeld, einen Versuchsaufbau für andere mit einer gewissen Unsicherheit, was dabei herauskommen würde. Gerade für Künstler*innen ist München ein heißes Pflaster. Mietpreise werden mehr und mehr unbezahlbar, gleichzeitig schmücken sich Städte mit Kreativen, setzen doch gerade sie Impulse und Ideen frei. Und gute Ideen sind gerade jetzt, in Zeiten klammer (Haushalts)Kassen, nötiger als wohl je zuvor. Kürzungen stehen überall an, gerade in der Kulturförderung. Für das Fassadenprojekt hat Gatermann deswegen kein Konzept entwickelt, bei dem ein „hübsches, buntes Haus“ heraus- und am Ende wohl noch zum Instagrammotiv verkommt. Egal, wie das Licht darauf scheint, dekorativ, ist das Ergebnis nicht. Stattdessen ist die Fassade eher wild und gerade im so cleanen München herausfordernd. Doch die Graffitis schaffen einen (Diskussions-)Raum zwischen der Aufwertung durch Kunst und Degentrifizierung. Reclaim Space ist als Versuch zu verstehen, zu vermitteln, ja herauszuschreien, wie wichtig für eine Stadt die (unangepasste) Kunst jenseits der „glatten Fassaden“ ist; gerade für eine wie München, die so sehr auf Wachstum getrimmt ist und sich viel über ihre Oberflächen definiert. Doch für Kunst muss man als Stadt etwas tun, in sie investieren, sie fördern und nicht zuletzt für sie den Mietpreis für Wohnungen und Ateliers deckeln. Damit es, unter all dem finanziellen Druck, denen Künstler*innen besonders in München ausgesetzt sind, am Ende nicht heißt: Der letzte macht das Licht aus! Das wäre sicherlich, der ultimative, der radikalste Schritt. Und bis es dazu kommt, ist es ein langsamer, ein schleichender Prozess, den es aufzuhalten gilt. Dazu trägt die Kunst bei, indem sie Dinge sichtbar macht, die da sind, aber oftmals unsichtbar erscheinen.
So wie beim Licht. Licht sieht man nicht. Aber Kunst kann auf ihre Weise sehend machen. Vieles. Selbst das Licht.
[1] So gehörte Fabian Gatermann etwa zu den 24 Künstler*innen, die das Museum für Konkrete Kunst und der Kulturspeicher in Würzburg 2024 zu ihrer Ausstellung „24! Fragen die Konkrete Gegenwart“ erwählten.
[2] Otto Carlsund, Theo van Doesburg, Jean Hélion, Léon Tutundijan, Marcel Wantz, „Base de la peinture concrète“ (Grundlage der konkreten Malerei), in: Art Concret, 1, 1930, S. 1–4, zit. n.: Charles Harrison, Paul Wood (Hrsg.), Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Bd. 1, 1895–1941, Ostfildern 1998, S. 441. Das Manifest wurde zwar von den aufgeführten fünf Künstlern unterzeichnet, sein Text wird aber weitestgehend van Doesburg zugeschrieben.
[3] Dieses Zitat stammt aus der Beantwortung des Fragenkatalogs, welches die Kurator*innen der Ausstellung „24! Fragen an die Konkrete Gegenwart“ allen Künstler*innen zur Bearbeitung gegeben haben.
[4] Vgl. dazu Benita Meißner, Simone Schimpf, Walter Zahner (Hrsg.), Über das Geistige in der Kunst – 100 Jahre nach Kandinsky und Malewitsch, Wien 2018.
Theres Rohde
No light, no work
Anyone browsing through Fabian Gatermann’s catalog will see a wealth of works that – despite their diversity – all revolve around one thing: Light. The artist always works differently, but always with light. If you keep common clichés in mind, you wonder how this is supposed to work. The painter picks up a brush and applies paint to a canvas. The sculptor works the stone with a hammer and chisel. And Fabian Gatermann, reaches for the light? Impossible, because light is incomprehensible – and not just in the sense of touching it. You can’t even see it. Light is an electromagnetic wave that moves through space, a form of energy that spreads but has no physical substance. We perceive what light does, but we are blind to the light itself. If there is any form of description at all, it is through the characterisation of wavelength, frequency or intensity. How sober, how factual, how unsatisfactory. This may be enough for pure natural scientists, but not for anyone who questions the world beyond that.
Light is there, but you can’t see it. Light needs other things to appear. It’s strange how dependent it is when it itself is what makes other things possible in the first place – growth, for example. If there were no light, our nature would look not thrive. One might think that Fabian Gatermann, as an artist, cares less about nature. After all, according to some curators, he belongs to Concrete Art. Concrete art has little to do with nature. Didn’t it make a great effort around 100 years ago to free itself from trying to reproduce nature and its phenomena? At least that is what Theo van Doesburg and his allies made clear in 1930 in the Fundamentals of Concrete Art, which states: „The work of art must have been completely designed and shaped in the mind before its execution. It must not contain any forms dictated by nature, sensuality or feeling.“ That may all have been true. But that was 100 years ago. Concrete art – and with it its strict drawing of lines and boundaries in terms of design and content – has developed further and now allows itself to transgress many a boundaries.
In works such as Flowers, Gatermann combines the principles of Concrete Art with natural phenomena. What you think you see in them are flowers. However, they are created differently to naturalism, for example, which attempted to depict “real life” as closely as possible. Instead, Gatermann creates a drawing with a pen and plotter using a short software code that describes a kind of cell division and defines when and how a line divides. Using a pipette, he sprinkles the resulting skeleton with water at certain points, so that colorful, floral motifs emerge from the line formation, which are no longer driven by the code, but by coincidence, carry a destructive moment within them and are as unpredictable as scientists observe in growth processes in nature itself. Gatermann thus has a new role as an artist that moves away from the idea of an “artistic genius”. For it is not he who is creating here, but rather he is initiating a transformation – and in doing so, he is fully in line with Concrete Art. In the end, the process itself creates its own aesthetic.
It is precisely the desire to experiment, to work with and on experimental arrangements, the realization that series can often explain principles most vividly, that connects concrete art and science. As is so often the case in his art, Fabian Gatermann had to search for the right material for a very long time in order to be able to capture the process that he focuses on. In Flowers, it is central that color can flow and merge into different color components. So it couldn’t be handmade paper or coated paper. In the end, only Japanese paper is suitable. A lot of things in art work by trial and error, similar to what we know from science. Order and chaos are not mutually exclusive – not only because what is depicted in her pictures is often not as rational and unambiguous as it might appear at first glance, but also because chance often has a say.
Fabian Gatermann’s relationship to Concrete Art is ambivalent and fluctuating. He has found his own way of dealing with it. His answer to the question of what this art movement means to him, for example, is: “For me, concrete art contains valuable starting points from which I draw my own lines.” Somehow he feels he belongs to Concrete Art – and somehow not. The clear formal language, the sequencing, the repetition, the rhythm – he feels connected to Concrete Art with all of this and ties in with it in his works. At the same time, he always dares to consciously cross boundaries without completely detaching himself from it – Concrete Art. For Fabian Gatermann, it is not enough to simply refer to mathematics. Art must not exhaust itself in mathematics, in geometry. There has to be something that goes beyond that. But the idea that what we see in concrete art is both a pictorial medium and pictorial content is particularly appealing to him. He does not make it easy for himself, because his medium and content is light – and, as we now know, it is so difficult to depict. Those who make light the center of their art have to think outside the box – and often design with it. Fabian Gatermann’s works not only need light, but also space.
Precisely because its windows – the finestra – are not set into the wall, but extend at right angles from the wall into the room, creating a corner. The light shines through the glass, dichroic, deliberately colored panes – because the color is always part of the light – and paints changing images on the wall depending on the time of day and the viewer’s point of view, which can only be perceived by the eye but would be impossible to grasp with the hands. But it is only through the interplay between the object built by Gatermann and what it creates on the wall through the incidence of light that his work is complete – and yet it is never complete without the viewers and their individual reception.
It is very similar with the LightEdges. They already have the corner in one of the possible translations of the English term in their name. They are objects made of Plexiglas bodies mounted on top of each other, which – depending on how the light shines on them – create color paintings on the walls. They also function, indeed they only “live” where light and space meet. At the same time, they do not reveal how the inventor Gatermann made them. The adhesive is invisible and yet indispensable, because it is what holds everything together. How long did he try until it worked – and how much frustration and dissatisfaction with his own work or with progress did he have to endure?
This dark part is probably inherent in every artist’s soul, even if you can’t see it in their works. In the end, the fascination that art unfolds is often achieved through what is hardly recognizable or explainable at first glance. So it was fitting that Fabian Gatermann showed his Plexiglas bodies in Munich’s Nazarethkirche in 2019 in his installation Lichtkreuzung. Churches have always been spaces whose architects were aware of the power of light and knew how to stage it. In doing so, they succeeded, certainly behind the knowledge of scientific laws, in transporting into the visible, tangible, even palpable, what in Genesis 1:3 was the beginning of everything: light. It is hardly surprising that Fabian Gatermann chose the church as his exhibition space. Not because he is so faithful to the Bible, but because he, who has tellingly given his catalog the title Transcendence, agrees that there is something that goes beyond itself, that is superior. Anyone who thinks that this has little to do with Concrete Art is mistaken and only considers the strands in the history of Concrete Art that concentrate purely on the mathematical and rational and ignores movements from the beginning. Kazimir Malevich and Wassily Kandinsky, for example, were very much searching for a “spirituality in art” and thus infected other generations of artists.
So there is something else, says Fabian Gatermann, and for him light is a way of expressing this. But those who work with light make themselves dependent on it. This has effects in different directions. Positive, because works such as the LightEdges, his wall steles, or the Finestra change depending on the time of day and the incidence of light, and they never show their viewers the same thing. Negatively, when the light doesn’t “work” the way the artwork and the artist need it to. When the day is grey, such works appear almost colorless. Not even the one thing that can often help: Money. Natural light can hardly be bought. It is therefore wonderfully ironic that the colored glass elements of his wall steles are located in magazine or postcard racks, of all places, which are otherwise familiar from salesrooms.
No light, no work – or only a part of it. What applies to natural light also applies to artificial light. Of course, it is easier to control. Because you can set it much more actively and consciously, switch it on and off. But even there is a dependency. Just take the superstring work. Without electricity, there’s not much in the way of art. All that remains is a box on the wall.
These works in particular show that Fabian Gatermann’s art is not only dependent on light. The viewers make a decisive contribution. They have to control the light objects, which Gatermann created from specially developed LEDS and raster lenses, Plexiglas and lenticular film, using the touchpad integrated into the frame and thus participate in the color images that open up in front of them. And when they move in front of it, they are even more captivated and amazed. This is essentially something that is necessary in all of Gatermann’s works: they are borderline experiences between sculpture, painting and physical phenomena and only unfold their effect when the movement of the viewer begins and new dimensions and perspectives open up again and again.
So it takes a lot for Fabian Gatermann’s artistic ideas to be realized. Sometimes it also takes multiple rounds of trial and error. Take his latest project entitled Reclaim Space, for example. Together with numerous other artists, less from the concrete and more from the graffiti scene, he took on the façade of Haus2 in the Kreativlabor in Munich, a collaborative space for artistic production from all disciplines. What was Gatermann’s role in this? To be the initiator of the project and to appear as one of the many artists. With what? Of course, with a light work consisting of the lettering ich du er sie they es wir ihr sie and placed over the corner of a house. This fits fabulously into the sequence of this text and leads to an ever better understanding of the artist: Gatermann, the one who works around the corner, the one who thinks around the corner. With the Haus2 project, he created an experimental field, a test setup for others with a certain uncertainty as to what would come out of it. Munich is a hot spot, especially for artists. Rents are becoming more and more unaffordable, while at the same time cities are adorned with creatives, as they are the ones who release impulses and ideas. And good ideas are needed more than ever right now, in times of tight (budget) budgets.
Cuts are being made everywhere, especially in cultural funding. Gatermann has therefore not developed a concept for the façade project in which a “pretty, colorful house” emerges and in the end probably degenerates into an Instagram motif. No matter how the light shines on it, the result is not decorative. Instead, the façade is rather wild and challenging, especially in such a clean city as Munich. But the graffiti creates a (discussion) space between gentrification through art and degentrification through art. Reclaimed Space can be seen as an attempt to convey, even shout out, how important (non-conformist) art is for a city beyond the “smooth facades”; especially for a city like Munich, which is so geared towards growth and defines itself a lot through its surfaces. But as a city, you have to do something for art, invest in it, promote it and, not least, cap the rent for apartments and studios for it. So that, amid all the financial pressure that artists are exposed to, especially in Munich, it doesn’t end up being a case of: the last one turns out the lights! That would certainly be the ultimate, the most radical step. And until that happens, it is a slow, creeping process that needs to be stopped. Art contributes to this by making things visible that are there but often appear invisible.
Just like with light. You can’t see light. But art can make you see in its own way. A lot of things. Even light.
[1] So gehörte Fabian Gatermann etwa zu den 24 Künstler*innen, die das Museum für Konkrete Kunst und der Kulturspeicher in Würzburg 2024 zu ihrer Ausstellung „24! Fragen die Konkrete Gegenwart“ erwählten.
[2] Otto Carlsund, Theo van Doesburg, Jean Hélion, Léon Tutundijan, Marcel Wantz, „Base de la peinture concrète“ (Grundlage der konkreten Malerei), in: Art Concret, 1, 1930, S. 1–4, zit. n.: Charles Harrison, Paul Wood (Hrsg.), Kunsttheorie im 20. Jahrhundert, Bd. 1, 1895–1941, Ostfildern 1998, S. 441. Das Manifest wurde zwar von den aufgeführten fünf Künstlern unterzeichnet, sein Text wird aber weitestgehend van Doesburg zugeschrieben.
[3] Dieses Zitat stammt aus der Beantwortung des Fragenkatalogs, welches die Kurator*innen der Ausstellung „24! Fragen an die Konkrete Gegenwart“ allen Künstler*innen zur Bearbeitung gegeben haben.
[4] Vgl. dazu Benita Meißner, Simone Schimpf, Walter Zahner (Hrsg.), Über das Geistige in der Kunst – 100 Jahre nach Kandinsky und Malewitsch, Wien 2018.